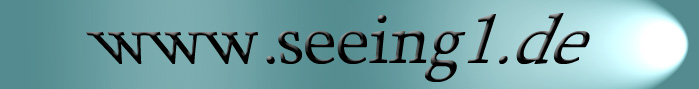
Der Kontrabass
Kleine Bildergalerie
"Drei Chinesen mit dem Kontrabass", das ist das häufigste Zitat, das ich höre, wenn ich mit meinem Instrument unterwegs bin. Meist werde ich belächelt, oder noch schlimmer, bemitleidet. Dabei ist das Instrument trotz seiner Größe recht gut zu transportieren. Na klar, das ist keine Flöte, aber mit ein paar kleinen Tricks kann ich auch mit dem Kontrabass recht flink unterwegs sein.Und damit bin ich schon beim wichtigtsten Merkmal dieses Instruments: Seine Größe. Dementsprechend sind auch seine Spitznamen:
"Der Schrank", "Die Hundehütte" , "Die Kiste" oder ( ganz gemein ) "Das Brennholz".
Bei diesen Spitznamen gibt es aber keine schlimmere Bezeichnung als "Die Bassgeige". Das ist absolut unwürdig, denn der Kontrabass ist nicht einfach nur eine große Geige. NEIN! Der Kontrabass ist ein eigenständiges Instrument der Streichinstrumentenfamilie. Er ist in seiner historischen Entwicklung eher mit den Gamben verwandt und hat teilweise sehr merkwürdige Schöpfungen des Instrumentenbaus hervorgebracht.
Nennen sie ihn also bitte nie Bassgeige.
Schauen wir ihn uns doch einfach mal genauer an.

Sieht nicht schlecht aus, fast schon wie ein schönes Möbelstück. Die vordere Holzseite des Instruments nennt man Decke. Meistens ist sie aus Fichtenholz, aber auch Ahorn und andere Holzsorten werden verwendet.
 |
Die hintere Holzseite nennt man Boden. Für den Boden wird öfter Ahorn genommen, aber auch hier werden andere Holzarten verwendet. Es gibt auch billige Bässe, die ganz aus Sperrholz gefertigt sind, die klanglichen Eigenschaften dieser Bässe sind aber meist ungenügend. Zumindest die Decke sollte aus Fichte sein. Wenn ein Kontrabass ganz aus echtem Holz ist, so spricht man von einem Massivholz-, Vollholz- oder Ganzholzbass. Diese haben die besten klanglichen Eigenschaften sind aber auch teurer. Wie das Instrument gebaut wurde, Serienfertigung oder welcher bestimmte Bassbauer, ist natürlich für die Qualität auch entscheidend |
Der hier abgebildete Kontrabass ist ein Mittenwald Kontrabass aus dem Karwendel anno 1986, aus Serienfertigung. Er hat eine Decke aus Fichte, Zargen und Boden sind aus Sperrholz. Dies hat auch einen Vorteil, nämlich daß er gegenüber Massivholzbässen bei starken Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen bisher keinerlei Risse bekommen hat und auch durch Transport bisher keinerlei Schaden genommen hat (Flug-, Zug-, Autoreisen). Als Reiseinstrument ist er also bestens geeignet. Klanglich hat sich dieses Instrument überaus gut entwickelt. Im Orchester, aber auch in der Kammermusik, hat er sich mit einem schönen, runden, warmen und kräftigem Ton bestens bewährt. Im solistischen Bereich stößt man mit ihm dann an seine Grenzen.
Er ist mir ein jahrelanger treuer Begleiter auf dem ich immer noch gern spiele.
| Von der Seite gesehen wirkt der Kontrabass eher "flach". Die Holzseiten mit denen Decke und Boden verleimt sind nennt man Zargen. Oft werden mit Zargen auch nur die Einbuchtungen bezeichnet. Diese Einbuchtungen müssen sein, damit man auf der höchsten und tiefsten Saite streichen kann, ohne den Korpus zu treffen. |  |
 |
Beachten sollte man besonders die herabfallenden Schultern, die sonst kein Streichinstrument hat.
Dies ist auch ein typisches Merkmal der Gambenbauweise, hat aber für den Kontrabass wegen seiner Größe einen praktischen Aspekt: Man kommt besser ans Griffbrettende in die höheren Lagen (Spielpositionen der linken Hand). |
| Ganz oben ist der Wirbelkasten mit der bekannten Schnecke und den Wirbeln zum stimmen der Saiten. Anders als bei den anderen Streichinstrumenten sind die Wirbel nicht einfach nur ins Holz gepflockt, sondern mit einer Drehmechanik versehen. Nur so lassen sich die dicken Saiten genau stimmen. Man spricht auch von der sogenannten "Wirbelmaschine". Die Saitenauflage nennt man Sattel. | 
|

|
Der Hals mit aufgeleimten Griffbrett (schwarz). Das Griffbrett ist deutlich länger als der Hals damit man höhere Töne "greifen" kann. |
| Schauen wir weiter. Da sind auch noch die auffälligen "F- Löcher". Sie sind nicht nur Zierde, aus ihnen tritt der Schall der im Resonanzkörper erzeugt wird aus, das Instrument kann klingen. Die Form des "F" ist historisch entstanden und bezieht sie auf den "F"- Notenschlüssel. Alte Gambeninstrumente haben auch Schall- Löcher in Form eines "C", des "C" Notenschlüssels, der früher gebräuchlicher war. | 
|
 |
Schaut man von vorne durch das rechte F- Loch, so sieht man die Stimme oder auch den Stimmstock. Die Stimme ist neben dem F-Loch in den Korpus geklemmt. Ohne die Stimme würde der Korpus unter dem Druck der Saiten einbrechen. Außerdem überträgt die Stimme die Schwingungen der Decke auf den Boden und sorgt so für mehr Klang. |
| Der Steg mit den Saiten ist wie bei allen Streichinstrumenten charakteristisch. Als Steg bezeichnet man die Saitenauflage. Der Steg ist übrigens nicht auf den Korpus des Instruments geleimt, sondern wird nur durch die Spannung der Saiten gehalten. Ohne Saiten fällt er ab. Man kann ein wenig die Dicke der Saiten erahnen. Die dickste ist ca. 3-4 mm dick. Es gibt auch Bässe mit einer fünften, noch dickeren Saite. Bei der Besaitung fällt der Kontrabass nicht nur durch die Dicke der Saiten aus dem Rahmen. Er ist nicht in sogenannten Quinten (7 Halbtöne), wie alle anderen Streichinstrumente gestimmt, sondern im kleineren Intervall, der Quarte (5 Halbtöne). | 
|

|
Unten ist der Saitenhalter. Der Saitenhalter ist meist aus Rosenholz, bei einfachen Instrumenten aber oft nur aus Plastik. Der Saitenhalter ist mit starkem Draht am Stachel aufgehängt. Nimmt man die Saiten ab, so fällt der Saitenhalter herab. |
| Wie der Name sagt, hält der Saitenhalter die Saiten. Die Saiten sind am Ende mit dicken Stahlknöpfen versehen. Die Saite wird durch den Saitenhalter hindurchgezogen und vom Stahlknopf gehalten. | 
|
 |
Ganz unten ist der Stachel. Er ist in der Höhe verstellbar und nur in den Korpus gesteckt, nicht geleimt. Hier ist an den Stachel übrigens ein Gummiteller angeschraubt , damit der Bass auf glattem Boden nicht wegrutscht. Manche rammen den Stachel einfach in den Boden. Doch bei Marmor ist das dann problematisch. Außerdem gibt es etliche Veranstalter, die nur ungern ihren Fussboden ruinieren lassen. Der Draht, mit dem der Saitenhalter befestigt ist, ist auch zu sehen. |
Man kann den Kontrabass zupfen aber auch streichen.
Zum Streichen braucht man noch einen Bogen.

Dies ist ein Bogen deutscher Bauart. Über den Bogen gibt es auch noch einiges Interessantes zu erzählen, daher
hat er eine eigene Seite.
Damit kann man nun spielen...


Auf anderen Seiten bei Seeing1 gibt es noch mehr über den Kontrabass,über seine Geschichte, über Spieltechnik und den Einsatz im Orchester sowie als Soloinstrument, alles mit Notenbeispielen. Einfach mal im Menü schauen.
Die Seiten werden nach und nach fertiggestellt.
Kurze Geschichte des Kontrabasses
Über Saitenanzahl, Stimmungen und Bauweisen
Bis zu etwa zur Mitte des 17. Jh. war die instrumentale Musik streng der vokalen untergeordnet. Rein Instrumentale Musik war von den Kirchen als weltlich verachtet und fand daher noch keinen Eingang in der höfischen Musik. Die Streichinstrumente waren als Gamben aus den volkstümlichen Instrumenten stilistisch entwickelt und den klanglichen Vorstellungen angepasst. Gamben haben einen leiseren und etwas fahlen Klang. Charakteristisch für die Bauweise waren ein flacher Boden und herabfallende Schultern. Oft waren sie mit Bünden auf dem Griffbrett ausgestattet. Gamben wurden vorrangig gespielt.
In der Renaissance gewann die Instrumentalmusik zunehmend an Eigenständigkeit. Mit Barock und besonders der Klassik entstanden völlig neue klangliche Ansprüche an die Instrumente. Die Familie der Violininstrumente verdrängte aufgrund eines helleren und lauteren Klanges die Gamben.
"Kombo" um 1750 mit Bass


Während Geige, Bratsche und Cello früh zu einer einheitlichen Bauweise und der 4 saitigen Stimmung in Quinten gelangten, nahm der Kontrabass hier lange Zeit eine "Zwitterstellung" ein. Aus dem 18. Jh. sind noch etliche verschiedene Bauweisen überliefert, mit unterschiedlicher Saitenzahl und Stimmung. Heute sind bis zu 20 (!) verschiedene Stimmungen der Saiten aus dieser Zeit bekannt. Instrumente mit mehr als 6 Saiten die ähnlich einer Arpeggione mehrstimmig gespielt wurden sind historischem Bildmaterial zu entnehmen. Es gab kleinere Bariton und Tenorinstrumente. Aufgrund der Vielfalt gab es die Bezeichnung Kontrabass im eigentlichen Sinne nicht, es wurde vielmehr vom Violon oder der Violone gesprochen
Französicher "Kontrabass"
um 1780, ital. Bauart

um 1780, ital. Bauart

Erwähnenswert seien hier nur die Wiener Kontrabässe mit 4 (5) Saiten in der sogenannten "Terz-Quartstimmung". Diese Instrumente bildeten für gut 30 Jahre im deutschsprachigen Raum das Hauptinstrument der Bassisten. Die ersten Kontrabass-Solowerke Dittersdorfs, Spergers und Vanhals waren höchstwahrscheinlich für diese Stimmung ausgelegt.
Um 1800 setzten sich 2 Kontrabässe durch:
- der 4 saitige Kontrabass in Quartstimmung
- der 3 saitige Kontrabass in Quintstimmung
Dragonetti mit 3 Saiter


3 saitige Instrumente wurden in Quartstimmung von Domenico Dragonnetti und Giovanni Bottesinni im 19. Jh. als Soloinstrumente gespielt. Die tiefste Saite wurde weggelassen. Hierbei wurde aber für einen brillianteren Klang die Stimmung um einen Ganzton erhöht. Diese wird auch heute noch als sogenannte "Solostimmung" bei der Aufführung von Solokonzerten angewandt.
Genormte Maße wurden erst im 20. Jh. festgelegt. Ein gewölbter Boden wie bei den anderen Streichinstrumenten ist inzwischen Standard. Kennzeichnend sind immer noch die herabfallenden Schultern. Diese Bauweise ist spieltechnisch zum Erreichen der Daumenlagen notwendig.
Auch beim Kontrabass gibt es normierte Größen: halbe, dreiviertel und ganze Kontrabässe. Halbe Bässe sind reine Schülerinstrumente. Die anderen beiden sind für Bassisten unterschiedlicher Statur. Im Orchester gibt es noch den 5-Saiter mit einer zusätzlichen tiefen Saite für die Suboktave, die einen unglaublich klangfüllenden Effekt hat. Brahms ohne 5-Saiter ist für mich beispielsweise unvorstellbar.
Trotz der inzwischen einheitlichen Stimmung und Bauweise werden immer noch gerne Instrumente in historischen Bauformen gebaut oder restauriert. Sie finden daher im Orchester oft noch Instrumente in italienischer Bauweise, Instrumente mit flachen Böden wie bei Gamben und auch die Bassetto Bauform. Zunehmend an einer historischen Aufführungspraxis orientiert werden auch alte Wiener Kontrabässe restauriert und mit Quartstimmung wieder eingesetzt.